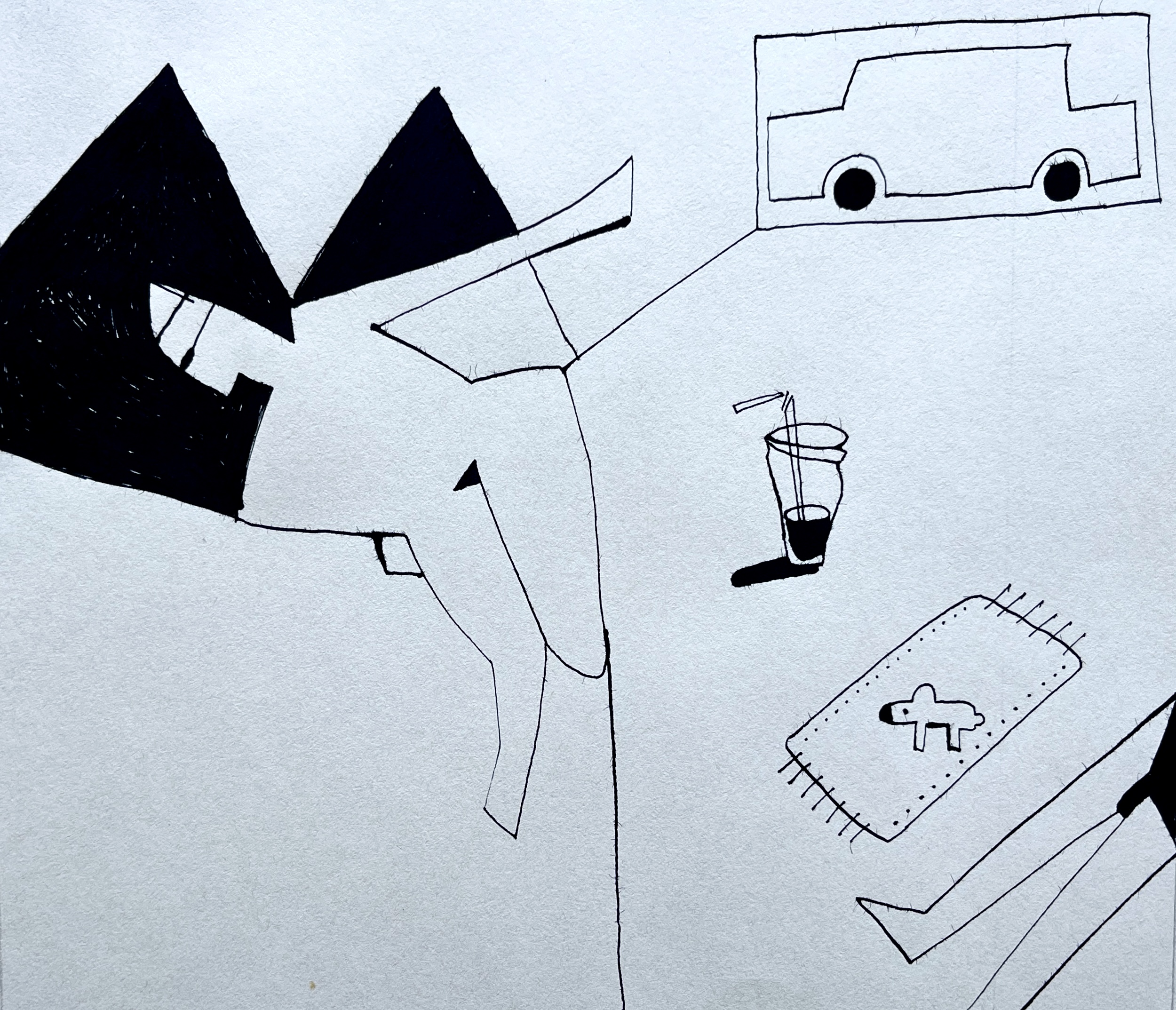Eltern und Sex?
Können wir überhaupt über die Sexualität, die körperliche Liebe unserer Elterngeneration nachdenken? Tja, es ist kompliziert …
Elternsex? Thanks, but no thanks!
Nichts sortiert man innerlich so weg wie die lebensbegründende Geschlechtlichkeit der Eltern. Und äußerlich schiebt man sie erst recht beiseite. In der Erfolgsserie Modern Family (2009-2020) wird über viele Staffeln, über echtzeitliche Jahre hinweg der ‚traumatische‘ Moment reflektiert und immer wieder angespielt, in dem die drei Kinder ihre Eltern Claire und Phil einmal beim Liebemachen erwischten. Erste Reaktion: Wut und Ekel. Dann die Forderung, die Eltern sollten ein Riegelschloss an die Schlafzimmertür schrauben. Doch dieser Riegel, wenn betätigt, machte ein durchs gesamte Haus hallendes ‚KLACK‘! Das allein reichte schon, um die Kinder wiederum angewidert das Weite suchen zu lassen …
Wo komme ich her? Die große, kindliche Frage der Menschheit. Kein Individuum ohne Eizellen und Spermien, was auch immer deren Träger vor, bei oder nach dem Akt miteinander verband. Sexualität ist diese tierische, triebliche Angelegenheit, wo man fast zwanghaft an Körperflüssigkeiten denkt, Befruchtung, Besamung, Begattung. Zumindest denkt man an Körperliches.
Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn Sex ist auch eine Kulturtechnik, Sex ist ein Gedanke, eine Idee. „Liebe als Code“, so ungefähr hat es der Soziologe Niklas Luhmann einmal formuliert. Und solche Codes, solche Konzepte sind gerade dann, wenn sie die Epoche der Eltern, die Herkunft betreffen, rasend interessant.
Sexualität als Konzept
Was war los mit unserer Elterngeneration, als sie uns erträumt hat, geplant, gezeugt, uns vielleicht sogar nicht haben wollte? Was für Ideen von Sexualität florierten in ihrer Lebenswirklichkeit? Zwischen welchen Konzepten kamen wir zur Welt? Als eines von vier Geschwistern aufgewachsen, alle geboren um 1980 von Eltern zwischen Ende Zwanzig und Anfang Dreißig – siehe dazu mein Roman Geschichte der Unordnung – habe ich mir ein subjektives, wildes, diverses Panorama erlesen. Aus internationalen Romanen, wegweisenden Schriften und Aussagen des Jahr 1975 und der näheren Umgebung. Was liegt da für uns seit nunmehr fast einem halben Jahrhundert bereit?
Erst einmal liegt da eine Frau auf einer Liege nahe des bretonischen Meeres. Sie dämmert in die salzige Luft, streichelt ihre Zwillinge. Ihr „wahres Leben“, so empfindet sie, begann mit dem ersten Kind. Jetzt hat sie so viele, dass sie sich deren Alter kaum merken kann – mit dieser Urmutter-Szene beginnt der Franzose Michel Tournier seinen Roman Zwillingssterne von 1975. Der Mutter gegenüber steht Alexandre, Bruder ihres Mannes, für den heterosexuelle Liebe eigentlich eine Art Müllberg ist. Eine Pärchen-Halde. Er, der schlanke, ungebundene Abfall-Unternehmer mit Lust auf Männer, bleibt stets allein. Gelegentlich sucht er sich auf den Straßen fremder Städte neue, immer neue Geschlechtspartner. Und er teilt die Welt in Weibliches und Männliches auf, naja, eher teilt er sie dem Männlichen zu. „Männliche Homosexualität: 1 + 1 = 2 (Liebe). Heterosexualität: 1 + 0 = 10 (Fruchtbarkeit). Weibliche Homosexualität: 0 + 0 = 0 (nichts)“.

Böse Mathematik: Michel Tourniers Roman Zwillingssterne
Diese Rechnung Alexandres lauert da einfach so in diesem passagenweise ziemlich starken Buch – und niemand wirft sie in die Luft, relativiert sie. Tournier, der Einzelgänger, hat womöglich die gesamte Verzweiflung eines Homosexuellen an der heteronormen Umwelt in diese Formel gepackt. So, wie vormals Gore Vidal seine eigensinnige Queerness in die Transfrau Myra Breckinridge, ein Roman von 1968. Myra lebt in Los Angeles und will Filmstar werden, sie ist ein Mann, der zur Frau gemacht wird: die erste chirurgisch fundierte Geschlechtsumwandlung der Literaturgeschichte. Und dann folgt die wohl erste Vergewaltigungsszene eines Mannes durch einen zur Frau umoperierten Mann – mit Strap-on! Dass das Geschlecht sozial und nicht biologisch bestimmt sei, behauptete Vidals Kultbuch unter anderem. Eine große These dieser Epoche der sexuellen Revolution, die auftrumpfend und zumeist männlich nach vorne walzte, für viele Gruppen allerdings nur bescheidene Wirkung zeigte. Denn Biologisches hin, Soziales her: Dass die Bedeutung der Frau ohne Mann zu Nichtigkeit tendierte, war damals leider gerade im bürgerlichen Durchschnitts-Schädel mehr als ein absurdes Gedankenspiel. Und so wurden dies auch die Jahre des Feminismus …
Als sei Weiblichkeit ein Land am Abgrund, rief die UNO 1975 das Jahr der Frau aus, um international darauf hinzuweisen, wie wichtig es sei, Frauen mehr ins Zentrum von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zu rücken. Das Magazin Der Spiegel, nur ein Beispiel, antwortete umgehend mit einem Titelthema. Man packte eine nackte hübsche Mama mit Kind aufs Cover und nannte das Ganze „Frau `75: Zurück zur Weiblichkeit“. Die Frauen beim Magazin konnten sich, falls sie Einwände gehabt hätten, offenbar nicht durchsetzen, waren doch von 78 Redakteuren nur acht weiblich, in der Schlussredaktion saß eine Frau 15 Männern gegenüber und von 16 hauptverantwortlichen Redakteuren der betreffenden Spiegel-Ausgabe: kein einziger weiblich. Alles im Kleingedruckten nachzulesen.
Frauen und Hinterwäldler:innen
Aus heutiger Sicht wundert es nur Hinterwäldler:innen, dass Verena Stefan in diesem Jahr Häutungen veröffentlichte, einen der wohl krassesten deutschsprachigen feministischen Texte überhaupt. Die gebürtige Schweizerin Stefan, seit 1968 für einige Jahre Wahl-Berlinerin, feuerte tausend spitze Pfeile auf eine Männerwelt, in der es keinen einzigen weiblichen Verlag, keine Frauenbuchhandlung gab. In der Männer (so in der BRD und auch in der Schweiz) noch zustimmen mussten, falls ihre Frauen Verträge unterschrieben, in der Schwangerschaftsabbruch illegal und Sexismus auf der Straße dem Recht des Stärkeren oblag. „Also, sag mal, mädchen, wo hast du denn deine brüste hängen?“ Von einem fremden Suffski auf der Straße so angequatscht werden, weil sie sich erdreistete, keinen BH zu tragen? Man kann lebhaft nachempfinden, dass Stefan sich „sprachlos“ fühlte, mehr noch, die „alltagssprache“ meiden und einen neuen Vibe erfinden musste.
ANZEIGE – Mehr Ruhe mit gute Leseschuhe

„Sie hat lange strecken von vergessen zurück / Gelegt, herzbrocken im geröll verstreut, felsen / Vor frische wunden geschoben / Ihre gefühle sind abgemagert“. Mich trifft das mitten in die Seele. Ich stelle mir meine Mutter vor, 1975 wohl gerade so eben noch nicht mit meiner 1976 geborenen ältesten Schwester schwanger, 25 Jahre alt und schüchtern. Eine stille Frau, die sich bei Tanzveranstaltungen am Rand versteckte und der die sexuelle Revolution, Rock’n’Roll, ja selbst die Erfindung der Verhütungspille wenig, und die Ökobewegung viel bedeutete. Obwohl sie zeitlebens das Informelle der 68er-Zeit pflegte, die Parkas, die schlotterigen Hosen, war meine Mutter doch irgendwie froh, irgendwie erlöst, dass mein Vater sie liebte, heiratete, eintütete: als Mama zu Hause.
Elfriede Jelinek schlussfolgerte in ihrem Roman Die Liebhaberinnen im gleichen Jahr: „wenn einer ein schicksal hat, dann ist es ein mann. Wenn einer ein schicksal bekommt, dann ist es eine frau.“ Kann man gut so stehenlassen, gerade für diese Zeit. Auch Stefans Wut und ebenso ihre Versuche mit lesbischer Liebe sind mehr als nachvollziehbar, mehr noch, die Aufrichtigkeit erhellt und erhebt.
Doch das Kopfschütteln, das sich bei Tourniers Frau-ist-Null-Gleichung einstellt, setzt sich doch auch bei Stefan immer mal wieder fort: „Die erste kolonialisierung in der / Geschichte der menschheit war die / Der frauen durch die männer.“ Wer sich bei dieser allzu großzügigen, ahistorischen Behauptung an loderndem Männerhass verbrennt, hat hingehört – auch beim nächsten Zitat, gleich auf der allerersten Seite von Häutungen: „Alle gängigen ausdrücke – gesprochene wie geschriebene –, die den koitus betreffen, sind brutal und frauenverachtend“. Zum Beweis: „bohren, reinjagen, stechen, verreißen, einen schlag hacken, mit dem dorn pieken usw.“ Warum sollte Stefan hier auf Polemik verzichten, war doch Vergewaltigung in der Ehe noch bis in die 1990er teils nicht strafbar …
»In die Muschel rotzen«? Ach, lieber nicht …
Allerdings, das sprachliche Nachvollziehen ihrer Brutalo-Verben ist nicht so ganz leicht. Im Duden der 1970er taucht Umgangssprachliches wie „mit dem Dorn pieken“ gar nicht auf. Ebenso wenig wird beispielsweise „Liebe machen“ als Wendung geführt, „kopulieren“ und „Kopulation“ gelten als veraltet, aufs Pflanzenreich bezogen. Nach langem herumblättern und einem Bücherwechsel führt das Synonyme-Lexikon der BRD von 1972 beim Stichwort „Sex“ zum Stichwort „Liebe“, bei „lieben“ wiederum zu „koitieren“. Dort bietet sich endlich eine teils hübsche, teils zärtliche, doch auch ins Verstörende reichende Bandbreite sexuellen Vokabulars, die weit über Stefans Polemik hinausgeht. Von „mit jemandem schlafen, ins Bett gehen“, „einswerden“, „erkennen (bibl.)“, über „in die Muschel rotzen“, „die Sichel putzen“ und „knallen“ zu „aufs Kreuz legen“, „umbiegen“ ist so ziemlich jeder Tonfall vertreten. CHECK, Text weiter oben, Toll, könnte auch gut zu Stefans brutalo-Verben … Benoite Groult denkt in ihrem erotischen Klassiker Salz auf unserer Haut (viel besser als der dumme Film) im Vorwort darüber nach, wie man Sex überhaupt nennen könnte, ebenso wie die Geschlechtsteile, wie man das alles darstellen könnte: Irene Kuhn hat übersetzt, Sonderausgabe von 1994
Stefans oder Tourniers Drastik sind Ausdruck einer auch heute noch sehr vertrauten Polemik, die sich beispielsweise im Februar 1975 im WDR-Fernsehgespräch zwischen Esther Vilar, der Autorin von Der dressierte Mann und einer damals noch nicht sehr bekannten Feministin namens Alice Schwarzer manifestierte. Während Vilar ihre Buch-Thesen wiederholte, Frauen hätten in Wahrheit das bessere Leben und Männer würden die Welt gar nicht beherrschen, wurde Schwarzer immer wütender. „Sie sind nicht nur eine Sexistin, Sie sind auch eine Faschistin“, wetterte sie – heute nachzuschauen auf YouTube, dieser Auftritt, der Schwarzer berühmt machen sollte. Das Zitat ungefähr bei 30:19 Min.
Sexualgeschichte beginnt erst richtig in den 1970ern
Der Forscher Vern Bullough bezeichnete die Sexualgeschichte in den 1970ern zu recht noch als „jungfräuliches Feld“, da im Grunde erst im späten 19. Jahrhundert begonnen. Doch selbst im deutschen Sprachraum gab es schon ein paar gute Darstellungen, etwa von dem Historiker Carl van Bolen. 1968 brachte er eine Neuauflage seiner Geschichte der Erotik heraus, die nun auch den sogenannten Kinsey-Report kritisch aufnahm. Dieser wohl erste (und aus den USA stammende) wissenschaftliche Versuch, die männlich und auch die weibliche Sexualität zu verstehen, war in zwei Bänden 1948 und 1953 erschienen, bald auch auf deutsch. Mahnend gab Van Bolen am Ende seines Buches zu bedenken, dass die auffällige zeitgenössische „Übererotisierung“ des gesellschaftlichen Lebens über Filme, Plakate und Revues „im Wesentlichen den Bedürfnissen des Mannes“ entspreche. Ein lässiges Eingeständnis, das man damals aus Männermündern nicht oft hörte – dafür beschwerte Van Bolen sich direkt danach über die neue „ausgedehnte Petting-Praxis“, die einen „Orgasmus ohne Coitus“ einbürgere. Schocker! Wer soll dann, bitte schön, die Kinder zeugen?!
1975 kam der US-Amerikaner James Salter mit seinem Buch Lichtjahre heraus, das viel poetischer ist als all diese Urteile und Polemiken. Selbst in dem als anrüchig empfundenen Sexroman A Sport and a Pasttime (1967) war Salter für Sozialpolitik zu fein. Die Wucht des Lebens schien auf ihn ebenso existenziell gewirkt zu haben wie der Wunsch nach einem zärtlichen Blick. Viri, der Protagonist aus Lichtjahre, liebt an seiner Frau Nedra die Intelligenz. Dass sie so schön still ist, zieht ihn wie magisch an. Er ist überwältigt von ihrer „submission“ – von ihrer Unterwürfigkeit? Tja, es kann auch Gehorsamkeit bedeuten … aber man vergisst das erstmal schnell bei solcher Innigkeit: „She passed by him, naked, her skin grazing his. He was overwhelmed by this vision of her, he could not memorize it, he could not have enough.”
Gerne will ich mir für eine Sekunde vorstellen, dass mein Vater, den ich kaum kannte, genau so von meiner Mutter überwältigt war. Schließlich hatte er sich schon zu Schulzeiten in sie verliebt, lebte mehr oder weniger immer an ihrer Seite, wenn nicht gerade auf Arbeit. Schiebt man die literarisch-romantischen Beschreibungen auseinander, schimmert jedoch auch bei Salter Kleinfamilien-Dynamik zwischen Mann und Frau durch. Verb oder Substantiv „possess“ und „Possession“ kommen während der sexuellen Anbahnung häufig vor, das Weib, ich entschuldige den Ausdruck, ist willig und lässt alles mit sich machen, „she would permit anything“. Der Mann schleicht um sie herum wie ein Raubtier, will sie „wie ein Fuchs“ auffressen. Und als Salters Protagonistenpaar heiratet, verliert die Frau, da sind Autor und Erzähler ziemlich genau, nur „eine Stunde“ nach der Trauung ihre Identität. Jetzt läuft sie einfach beim Mann mit. Während der weiter als Architekt arbeitet, ist sie mit den Kindern daheim …
Das Salter’sche Ehepaar kritisieren? Mir fällt das schwer, verkörpert es in den guten Momenten doch ein Ideal, dass fast alle Menschen hierzulande (noch) kennen und das die meisten, laut oder mehr im Stillen, lieben, beträumen, vermissen. Außerdem sind Salters Figuren allesamt stark und tief, egal ob weiblich oder männlich. Unabhängig von den Konzepten ihrer Zeit sind sie nicht. Da ist es beruhigend zu wissen, dass auch vor fünfzig Jahren schon Möglichkeiten bestanden, sich den eigenen Raum im Kleinen oder zumindest in der Fantasie selbst zu gestalten. Gabriele Wohmanns Schönes Gehege kam 1975, ein Jahr nach dem großen Caspar-David-Friedrich-Jubiläum, mit dessen Gemälde Großes Gehege auf dem Cover heraus. In der Gruppe 47 war Wohmann nur ein stiller Gast gewesen. Doch behauptete sie das menschlich-künstlerische Recht der Frau, sich jedem Thema, jeder Figur zu widmen. Sich zum Beispiel einfach einen Mann zu erfinden. Wohmann war bereits Anfang 40 (ungefähr zehn Jahre älter als Stefan, Schwarzer oder Jelinek), als sie die Schriftsteller-Figur Robert Plath ersann. Wie ein Flaubert in seine Madame Bovary geschlüpft war, mehr als hundert Jahre zuvor, kroch Wohmann in ihren Protagonisten. Gleich zu Beginn hat ihr Schriftsteller, dem sie sicherlich nicht umsonst den Nachnamen einer der berühmtesten Schriftstellerinnen aller Zeiten gegeben hat, den Sylvia Plaths, eine Epiphanie. Er beobachtet seine Frau Johanna, die sich viel besser auf Partys bewegt als er, einfach sie selbst sein kann. Er bewundert sie, „er spürte die Zuneigung zu seiner Frau bis in die Fingerspitzen“. Sonst quält ihn meist Sozialphobie, ständig muss er sich ärgern – schon wieder steht bei einer Party irgendeine unfreiwillige Gesprächspartnerin vor ihm, bezeichnet ihren Ausflug zum Buffet als „sündigen“, was Plath hasst: „das war endlich wirklich typisch weiblich“. Aus diesem Satz spricht die Autorin Wohmann. Klar, sie weiß es, Frauen müssen schlank bleiben, mehr noch, auch wenn sie nicht schlank bleiben, dürfen sie das nie vergessen – ähnlich wie es beim Mann mit Virilität und Stärke ist. Wenn er sie verliert, muss er die ganze Zeit darüber klagen – siehe den armen Plath …
Wohmann reitet nicht auf dem Mann-Frau-Unterschied, sie unterläuft, überformt ihn. Was das Sexuelle angeht, zieht sie sich geschickt aus der Affäre. Denn das Paar wird von Liebe und Zuneigung regiert. Andere würden das langweilig finden, aber Plath wünscht sich einfach, dass eine Frau und er „so einmalig gut miteinander auskommen, wie vielleicht nur wir beide das meistens können“. Die Ehe als Freundschaft: Nur wenige Romane hat sowas inspiriert. Über kumpelige Ehepaare wurde wahrscheinlich ausdauernder geschwiegen als über alle anderen Perversionen …
Im Spiegel wird Wohmann Buch, wie damals nicht untypisch, etwas raunend, jedoch wohlwollend besprochen – natürlich von einer weiblichen Rezensentin: Christa Rotzoll. In deren aufgeräumtem Band Emanzipation und Ehe: Zehn Antworten auf eine heikle Frage von 1968 steht im Vorwort: „Solange der Mann der Ernährer ist, ist die Ehe doch Prostitution.“ Vielleicht, aber man kann in jedem Fall auch einfach woanders hinschauen. 1975, in Bodensee-nähe, konzipierte ein Schriftsteller in seinem Tagebuch einen möglichen „Zukunftsroman“. Bisher glaubte man, der Mensch tue alles der Nahrung wegen. Doch er weiß mehr: „In der 2. Hälfte des 2. Jahrtausends, also etwa von 1600 bis 2000, war es die Sexualität“, die die Menschheit antrieb. Martin Walser heißt dieser Schriftsteller, von dem man munkelt, seine Lese- seien auch immer Liebesreisen gewesen. So oder so, er wird als Stilist in die Geschichte eingehen, als großer Konservativer. Als Visionär sicherlich nicht.
Vom Ende der Gewissheit
Obwohl ich etwas versinke in diesem Material, in immer neuen Nebenströmungen, changierend zwischen Frauendegradierung und Männerhass, Homosexualität und Heterosexualität, Macht und Leid, Körpern und Konzepten, fällt mir das Schwimmen doch relativ leicht. Was meine Eltern hingegen im Schlafzimmer angestellt haben mögen, darüber denke ich weiterhin nie nach. Meine älteste Schwester erinnert, sie nachts einmal beim „Turnen“ gestört zu haben, so jedenfalls erklärten die beiden ihre rotwangige Nacktheit zwischen hochgerafften Bettdecken. Sie darf dort im Privaten ruhig bleiben, die Decke des Verbergens, dann braucht man kein Modern-Family-Türschloss. Im Gegensatz dazu aber liegt die Diskussion blank, und das ist gut, es verschafft Klarheit. Rund um den Zeitpunkt unserer Geburt wurden postmoderne Sexualitäten geprägt, neue Verhältnisse, Versuche, Selbstverständnisse, neue Kritik und neues Können, die bis heute die Debatten prägen – und unser Leben.
Dabei habe ich hier nur willkürlich ein paar Steine umgedreht und erotische Klassiker aus den 1970ern wie etwa Erica Jongs Fear of Flying (1973) oder Anaïs Nins Delta of Venus (1977) erstmal außen vor gelassen. Man sieht, man hört, man spürt es dennoch überall: Diese Eltern-Epoche leitete das Ende der sexuellen Gewissheit und eine Epoche der Diversifizierung von Gewissheiten ein, von nun an in ständigem Ringkampf – ein endloses „business of challenging borders“, um eine Wendung der Kulturwissenschaftlerin Mieke Bal zu benutzen, 1946 geboren, vier Jahre vor meiner Mutter.
Mühelos lässt sich mit einem lockeren Blick in die Runde feststellen, wie das Heute auf dem Damals fußt. Gillian Anderson, die aus Akte X bekannte Schauspielerin, hat 2024 mit Want eine Anthologie anonymisierter weiblicher Sexfantasien aus dem 21. Jahrhundert herausgegeben, direkt auf Nancy Fridays Klassiker Die sexuellen Fantasien von Frauen rekurrierend, Deutsch 1978, der wahrscheinlich ersten wirklich populären Sammlung zu diesem Thema. Beim früheren Erscheinen in den USA eine hymnische Besprechung in der New York Times, von einer Autorin, die gleich gesteht, wie so viele Frauen immer behauptet zu haben, keine sexuellen Fantasien zu besitzen. Doch in Fridays Band lag jetzt alles vor, verbürgt durch 400 Berichte: „the rape fantasies, the licking dogs, the beatings, the donkeys, the Lesbians …“
The donkeys, die Esel?! Gerne mal bestellen und zu Hause nachlesen, ich muss jetzt in meiner Zeit nachhaken: 2010 reist Thilo Mischke In 80 Frauen um die Welt; fünfzehn Jahre später, um die letzte Weihnachtszeit herum, nimmt ihm der Podcast Feminist Shelf Control (und noch einige Menschen mehr) diese, so hieß es sinngemäß, sexistische Degradierung der Frau derart übel, dass eine Kampagne gegen ihn gestartet wird, die schlussendlich seine Anstellung bei der ARD verhindert.
Caroline Rosales‘ grandiose TV-Serie Sexuell verfügbar, auf Erkenntnissen auch ihres gleichnamigen Sachbuchs basierend, stellt seit 2024 in satirischer Umkehr den Vergewaltigungsprozess gegen eine Frau dar. Vorwurf: Sie habe einen Mann gegen dessen Willen mit einem Strap-on penetriert; Stefan hätte vielleicht gesagt: gebohrt, gepiekt.
Trotz einer Haltung, die nicht mehr alle teilen (siehe die Online-Kritik „Literature’s Most Famous Transsexual“ Is a Rapist), wirkt Gore Vidals postmoderner Trans-Roman Myra Breckinridge bis heute. Nicht nur, siehe Sexuell verfügbar, mit dem Strap-on. Sondern vor allem stilistisch. Der flirrende, theoretisierende Ich-Stil von Vidals Tagebuch-Geschichte dominiert auch Torrey Peters‘ Detransition, Baby (2021), wo eine Transfrau-Erzählerin um die Vierzig davon berichtet, wie schwer es ist, zu altern – und wie stark ihre Situation der Lage geschiedener Frauen im selben Alter ähnelt. Alvina Chamberlands Love the World Or Get Killed Trying (2024) scheint literarisch ebenfalls auf Vidals Traditionslinie zu liegen: mit kulturtheoretischen Gewichten, Zahlen, Fakten, feelings und schonungsloser Offenheit, die auch um sexuelle Gewalt kreist.
Unterdessen seziert Jenny Erpenbecks mit dem Booker Prize geadelter Roman Kairos 2024 die auf Machtgefälle, Unterwürfigkeit und Sadismus basierende Beziehung zwischen einer jungen Frau und einem deutlich älteren Mann, der sich später als Stasi-Mitarbeiter herausstellt. Was lange Standard war, vor allem beim Altersunterschied, gilt heute fast schon als Armour fou – aber durch Erpenbecks einfühlsame Beschreibung dieser Affäre in der DDR, zumindest anfangs, als die Beziehung noch gut läuft, entsteht ein etwas altmodisches, jedoch wirklich realistisches Bild körperlichen Begehrens.
Ob Salter das gefeiert, ob Wohmann sich gefreut hätte? Ob Verena Stefan den Feminist Shelf Control-Podcast zu Mischke hören wollen würde und Michel Tournier vom Einzelgänger zum Polyamourösen geworden wäre? Wer weiß. Sie leben längst nicht mehr. Doch ihre Ideen sind noch hier, es sind Bausteine unserer Sexualität.
Zitatnachweise
„wahres Leben“ – Tournier, Zwillingssterne, 1975, S. 9.
„Männliche Homosexualität: 1 + 1 …“ – Tournier, Zwillingssterne, 1975, S. 184.
„Frau `75: Zurück zur …“ – Titelstory von Der Spiegel, Nr. 27, 29. Jahrgang, 30. Juni 1975.
„Also, sag mal, mädchen …“ und die folgenden Zitate – Verena Stefan, Häutungen, S. S. 37, S. 34 und S. 49.
„wenn einer ein schicksal …“ – Elfriede Jelinek, Die Liebhaberinnen, zit. nach Böttiger, Die Jahre der wahren Empfindung. Die 70er – eine wilde Blütezeit der deutschen Literatur. Göttingen 2021, S. 55 –Elke Kummer in Die Zeit hatte keine Freude an Jelineks Buch: „Elfriede Jelinek formuliert drauflos und urteilt ab, noch ehe sie etwas beschrieben hat.“ (vgl. ebenda, S. 55) Wobei man mit gutem Recht einwenden darf, dass Kummer offenbar einen klassischen Beschreibungs-Prosa-Begriff an Jelineks postmoderne Reflektions-Literatur legt.
„Die erste kolonialisierung in …“ und das folgende Zitat – Verena Stefan, Häutungen, S. 69, S. 33.
„Kopulieren“ und „Kopulation“ sowie die folgenden Zitate – alles nach der Duden-Ausgabe von 1973 und dem Synonyme-Lexikon (Die sinn- und sachverwandten Wörter) des Duden von 1972.
„jungfräuliches Feld“ – Vern Bullough, zit. nach Franz X. Eder, Kultur der Begierde. Eine Geschichte der Sexualität. München 2022, S. 7, vgl. auch S. 10 für die oben im Text nachfolgenden Aussage.
„Übererotisierung“ und die folgenden beiden Zitate – Carl van Bolen, Geschichte der Erotik, 1968 (aktualisierte Neuauflage) S. 251 und S. 252.
„submission“ und das folgende Zitat – James Salter, Light Years, 1975, S. 48 und S. 49, deutsche Übersetzung nachliefern.
„possess, Possession“ – Salter, S. – Allerdings z.B. fast zeitglich publiziert, auch in Anaïs Nins Elena, Teil von Delta der Venus, „ehe Pierre sie verließ, wollte er sie noch einmal besitzen“, S. 40, oder S. 47 „genommen“, „er nahm sie“ … es ist auch ein sexuelles Vokabular, aber eben ein sprachlich aufschlussreiches … „ihr einen verpassen“ lässt ja auf den je gemeinten Akt auch durchblicken … so wie „genommen werden“, das bei Nin auch vorkommt in Elena … Das Delta der Venus. Aus dem Amerikanischen von Eva Bornemann. Stuttgart u.a. 1977.
„she would permit anything“ – Salter, S. 49
„er spürte die Zuneigung …“ und die folgenden Zitate – Gabriele Wohmann, Schönes Gehege,1975, S. 322, S. 15, S. 95.
„Solange der Mann der …“ – Anonym, zit. nach Christa Rotzoll (Hg.), Emanzipation und Ehe. Zehn Antworten auf eine heikle Frage. München 1968, S. 9.
„Zukunftsroman“ und das folgende Zitat – Martin Walser, Leben und Schreiben. Tagebücher 1974-1978. Reinbek bei Hamburg 2010, S. 76 (Eintrag vom 24.3.1975).
„business of challenging borders“ – Mike Bal, zit nach: Across the Borders with Mieke Bal. Interview von Milan Kreuzzieger mit Mike Bal, S. 455-463. In: Umění (Prag), vol. 49, no. 5, 2001, S. 457.
„the rape fantasies, the …“– Caroline Seebohm, Book Review of Nancy Fridays ‘My Secret Garden’, New York Times, 7. Oktober 1973, S. 400.