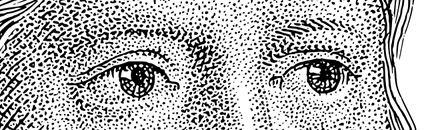Heute leben wir in Zeiten der politischen Positionen und »-ismen«.
Aber das war mal anders …
Erfindung der Weltanschauungen
Als der große Philosoph Friedrich Hegel in Berlin einmal von einer Dame der Gesellschaft bewundernd angesprochen wurde, soll er das Lob gleich abgewehrt und gerufen haben: »Was in meinen Büchern von mir ist, ist falsch!«

Wobei diese Anekdote zwar nicht wirklich belegbar ist, aber doch so aussagekräftig, dass sie der Philosoph Herbert Schnädelbach 1999 in seine berühmte, sogar als geistiger Rock’n’Roll bezeichnete Junius-Einführung zu Hegel aufnahm. Warum? Weil Hegel wirklich noch an die Philosophie im Singular glaubte und davon ausging, dass er sich nur an der Enthüllung ihrer gigantischen ewigen Struktur beteiligen, selbst aber nichts eigentlich Neues finden könne.
»Das Wesen der Philosophie ist … bodenlos für Eigentümlichkeiten«, fand Hegel. Das subjektive, persönliche, und also auch das, was er womöglich »falsch« aufgefasst haben könnte, fällt einfach unten durch. Und was stimmt, stimmig ist, wäre also nicht von ihm …
Mehr Buch-Infos hier
Hegel war wohl der letzte bedeutende Philosoph, der das noch glaubte. Seit dem 19. Jahrhundert nämlich, er starb zu dessen Beginn 1831 fast zeitgleich mit Goethe, bevor die erste Eisenbahn in Deutschland fuhr, seit dem 19. Jahrhundert sehen wir Philosophie nicht mehr in dieser Ausschließlichkeit, sondern eben als historistisch: als subjektiv und wandelbar. Und so sieht man seitdem eigentlich alles, denn das 19. Jahrhundert ist »die Epoche der Weltanschauungen«, so Schnädelbach.
Damit machte dieses erneuerungswütige Zeitalter jedes Wissen für immer angreifbar, weil es eine Perspektivierung einbaute: »Eine Weltanschauung ist so eine individuelle Sicht der Dinge: ein Blick aufs Ganze von einem bestimmten Standpunkt aus, der seinerseits eine bestimmte Perspektive festlegt; dies ergibt ein Weltbild, und das ist buchstäblich ›Ansichtssache‹, ja sie erfordert (wie bei einem Fernrohr) eine bestimmte ›Einstellung‹.«
Anfang des 19. Jahrhunderts konnte man an die Ganzheit glauben, heute hoffen wir höchsten auf Pluralitäten
Das 19. Jahrhundert hat mit dieser Perspektivierung eine Lawine der »…ianer« und »…isten« losgetreten, die bis heute andauert, siehe »Aktivisten, Feministinnen, Trumpisten« und so weiter. Mehr noch, diese Epoche der Weltbilder, so scheint es zumindest gerade, hat schlussendlich auch dafür gesorgt, dass sie selbst fortgespült zu werden droht (wie einst Gorbatschow von der auch durch ihn angestoßenen »Perestroika«).
In den Auktionshäusern wird das 19. Jahrhundert als Segment gerade einkassiert, im musealen Ausstellungswesen hat es, abgesehen von Superstar-Shows mit Caspar David Friedrich oder den Impressionisten, ohnehin kaum noch Relevanz. Nennenswerte Kunsthändler in diesem Bereich gibt es viele, doch neue dazugekommen sind in den vergangenen 20 Jahren nicht. Und die seitdem gestarteten größeren Sammlungen kann man an einer Hand abzählen. Währenddessen werden die kanonischen Gründer der bürgerlichen (also unserer) Literatur als alte weiße Männer weggelegt, viele Frauen wollen gerade gar keine Bücher von Autoren mehr lesen. Die damalige Technikrevolution zwischen Eisenbahn, Dampfer und Fließbandproduktion, die die Erde überhaupt erst zum Globus machte, schrumpft vor digitalisierten Gegenwartsaugen von der Schöpfungsbewegung zur unlesbaren Fußnote – oder zum Umweltproblem.
Kann uns das 19. Jahrhundert heute überhaupt noch etwas sagen? Wir finden: ja! Und wir wollen es sogar genauer wissen, was hat es uns zu sagen? Wir werden mit Fachleuten sprechen, die in kurzen anschaulichen Anekdoten berichten: Vom Beginn der Emanzipation und der Demokratie, von technischen Innovationen, von Literatur, Musik und Kunst, von unverzichtbaren Neuerungen im Sozialen, in Wissenschaft und Philosophie … to be continued
Alle Zitate aus Herbert Schnädelbach, Georg Wilhelm Friedrich Schlegel. Zur Einführung. Junius Verlag. Berlin 1999.